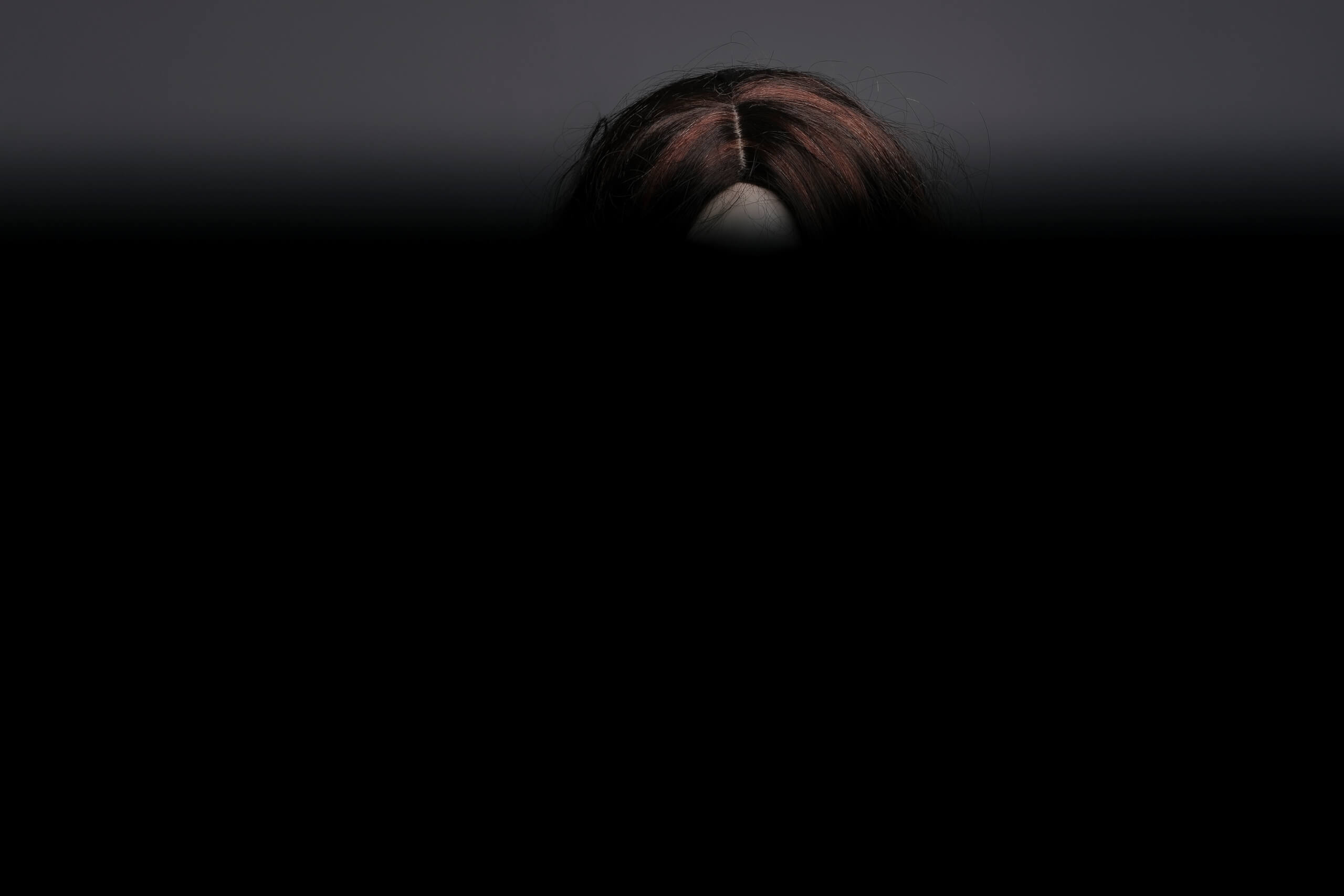II. Lichttemperatur
Stellen Sie sich eine schöne Abendstimmung vor. Die Schatten sind lang, das Licht fällt flach von der untergehenden Sonne auf die Landschaft. Die Übergänge von Licht zu Schatten sind weich. Das Licht erscheint orange, der Himmel verfärbt sich. Das Licht ist zu diesem Zeitpunkt "warm". Ebenso wie eine Glühbirne oder heute die "warmweissen" LED. Tagsüber ist das Sonnenlicht kühler. Die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben. Spannend dabei: Je "wärmer" das Licht ist, desto kleiner ist der Kelvinwert und je "kälter" es ist, desto höher ist der Wert.
Eine klassische Glühbirne liegt bei ca. 3000K, Tageslicht um den Mittag bei ca. 5600K.Unten finden Sie eine Grafike, die ich aus Wikipedia habe. Ein Klick auf die Grafik bringt Sie zum Artikel.

Quelle: Von Bhutajata - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44144928
Einfluss auf die Fotografie
Die Farbtemperatur beeinflusst direkt die Stimmung im Bild. Wollen Sie beispielsweise bei einem Winterbild die kalten Temperaturen betonen, können Sie dies mit etwas mehr blau (höherer Kelvinwert) erreichen. Ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer wird noch etwas gemütlicher, wenn Sie etwas mehr gelb-orange hinzufügen. Sie können die Farbtemperatur an der Kamera selber einstellen, verschiedene Voreinstellungen auswählen oder im Automatikmodus fotografieren, der in den allermeisten Fällen sehr gut funktioniert.
Wenn Sie im RAW-Modus fotografieren, haben Sie die Möglichkeit, die Farbtemperatur inkl. Tönung am Computer anzupassen, im JPEG-Format ist das nicht so gut möglich (es gibt Programme, die das ermöglichen, aber die "Bildinformation" ist oft nicht genügend gross, um starke Veränderungen ohne Qualitätseinbussen vorzunehmen.)
Mischlicht
Verschiedene Lichtquellen haben verschiedene Temperaturen, wie wir oben gesehen haben. Wenn zwei oder mehrere unterschiedliche Lichtquellen aufeinandertreffen, sprechen wir von Mischlicht. Stellen Sie sich vor, Sie machen ein Portrait in einem Raum. Das warme Raumlicht ist an und durchs Fenster dringt "kälteres" Licht. Wenn Sie den sogenannten Weissabgleich (s. unten) auf die warme Temperatur machen, wird das kältere Licht noch blauer. Gleichen Sie auf die kalte Lichtquelle ab, wird die andere Lichtquelle noch oranger. Hier gilt es nun einen guten Mittelweg zu finden, damit die portraitierte Person nicht zu orange oder blau daher kommt.
Der Weissabgleich
Damit weiss weiss erscheint, nimmt die Kamera einen sogenannten Weissabgleich vor. Sie können neben den Voreinstellungen in der Kamera auch eine Einstellung wählen, die Ihnen erlaubt, das Licht auf die vorherrschende Situation anzupassen. Es gibt sogenannte Graukarten, die Sie vorgängig abfotografieren. Diese Karte sagt der Kamera, wie neutrales Grau aussieht. Dieses Grau hat den numerischen Wert von 118,118,118 (roter, grüner und blauer Farbkanal). Der Computer in Ihrer Kamera korrigiert also automatisch den Farbstich und solange sich nichts an der Lichtsituation ändert, können Sie nun farbneutrale Bilder erstellen.
Ebenfalls ist es möglich, die Karte (im RAW-Modus) abzufotografieren und die Korrektur dann am Rechner zu machen. Denken Sie dran: Wenn Sie JPEGs fotografieren, sollten Sie die Korrektur direkt vor Ort machen, da es am Computer nicht mehr so gut möglich ist.
Wenn Sie einen Colorchecker verwenden, haben Sie sogar noch die Möglichkeit, die Farbstimmung zu nuancieren. Mit einem ColorChecker können Sie zudem mit einer zusätzlichen Software am Computer sogenannte Farbprofile für Ihre Kamera herstellen. Damit schöpfen Sie dann das ganze Potential Ihrer Kamera aus, wenn es um die Darstellung von Farben geht. Diese Profile ersetzen aber NICHT den Weissabgleich.